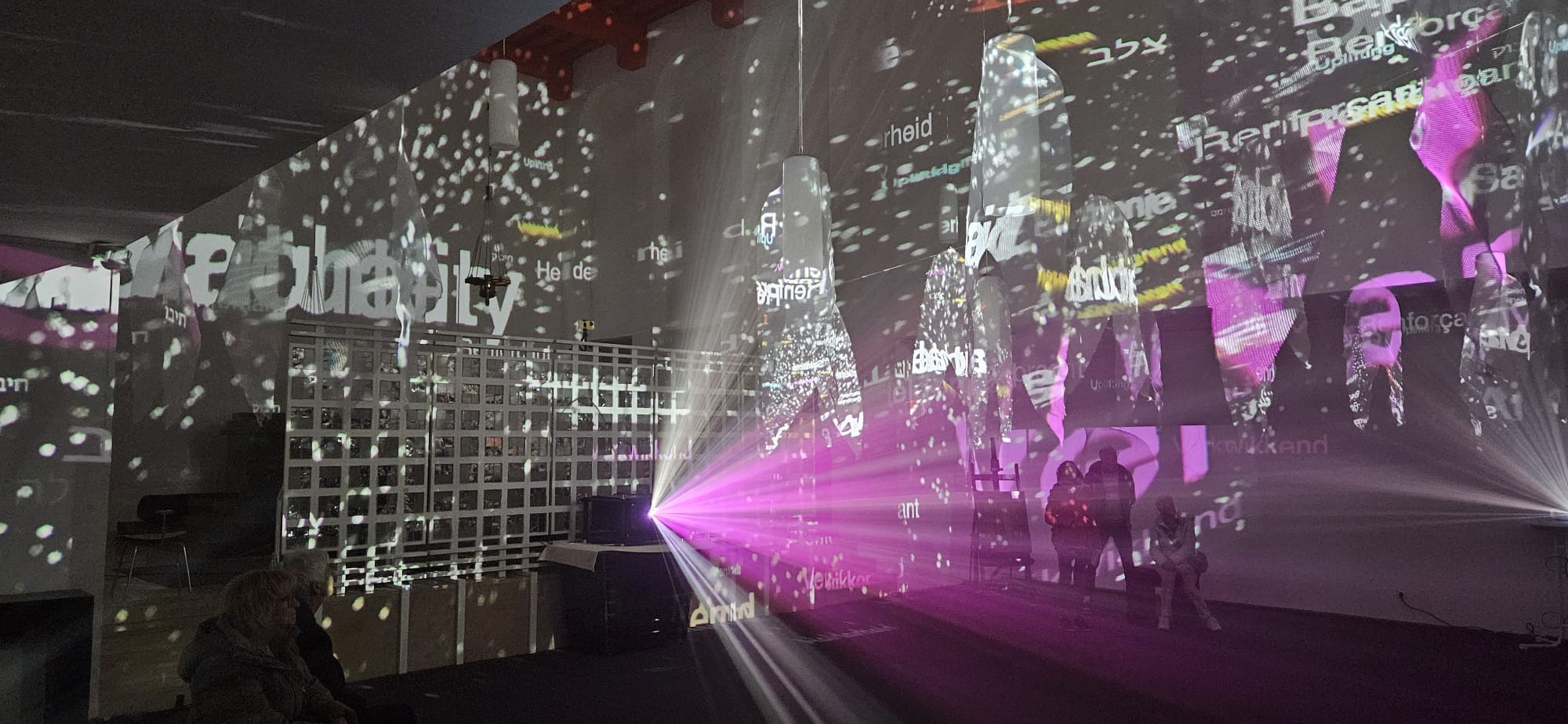Ein bekanntes Zitat wird unter anderem dem Dichter und Philosophen Khalil Gibran (1883-1931) zugeschrieben:
„Solange deine Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie größer werden, schenke ihnen Flügel.”
Es war nicht dieses Zitat, das uns inspiriert hat, und doch passt es. Dazu später.
Die Entscheidung „für“ ein Jahresthema 2024 entstand zunächst in einer Entscheidung „gegen“ etwas, das wir nicht wollten: „irgendwas mit Krise“.
Sicher hat es seine Berechtigung, dass „Krisenmodus“ als Wort des Jahres 2023 gewählt wurde. In ihrer Begründung modifizierte die Gesellschaft für deutsche Sprache einen Satz des Vizekanzlers: „Wir sind umzingelt von Krisen.“ Das aber hat Robert Habeck nicht gesagt, sonst müsste das Zitat nicht angepasst werden. In einer Talkshow vor etwa einem Monat sagte er vielmehr: „Der ganze Tag ist bedrängt von akuten Problemen, die sofort gelöst werden müssen.“ Und dieser Aussage setzte er voran: „Wir sind umzingelt von Wirklichkeit.“1
Treffender wäre vielleicht sogar, von „Wirklichkeiten“ zu sprechen. In Familie, Freundeskreis, Nachbarschaft, Arbeit, Medien, sozialen Netzwerken stellt sich jeweils anders dar, was da auf die Gesellschaft einkriselt. Die Meinungen über das Klima, die Ukraine, den Nahen Osten, die Schulden zerren in verschiedene Richtungen. Das führt die einen in Verschwörungsnarrative, andere in Resignation. Vor allem treibt es in Zersplitterung, in Spaltungen und Radikalisierungen, schon ganz banal und sprachlich.
Müsste sich da nicht bei denjenigen das Gewissen rühren, die doch noch ein Fünkchen Interesse an Zusammenhalt haben? Aber was ist es, dieses Gewissen?
Was ist dieses Gewissen?
Der Soziologe Niklas Luhmann (1927-1998) löste sich von der alten Vorstellung vom Gewissen, dass der Mensch in seinem „Innen“ dem Transzendenten begegne und von da aus frei das „Außen“ gestalte. Vielmehr bräuchte der Mensch das Gewissen als Schutzschild, um sich in all seinen unterschiedlichen Wirklichkeiten sicher bewegen zu können. Denn in jeder von ihnen treibt eine Fülle von Entscheidungsmöglichkeiten die Person zunehmend in die Enge. Das Gewissen ist in neuer Funktion eine Kontrollinstanz für die Persönlichkeit, damit ihre Grenzen nicht durch die Wirklichkeit gesprengt werden.2
Gewissensentscheidungen auf einer gemeinsamen Grundlage sind in diesem Konzept nicht erforderlich. Konsens ist weder notwendig noch zielführend.
Ist denn da die Arbeit an einer „Gewissenskompetenz“ nach wie vor sinnvoll? Oder, wie der Moraltheologe Eberhard Schockenhoff formulierte, „verkommt das Gewissen zu einem Handlanger der eigenen Interessenbehauptung“3, wenn es sich löst von ethischen Prinzipien, von gemeinsam gefundenen Werten und Normen?
Das christliche Konzept von Dialog und Bildung, Grundlage unserer Akademiearbeit, setzt gegen die Enge der eindrängenden Wirklichkeiten die Weite biblischer Möglichkeiten, die Zehn Gebote, das Liebesgebot Jesu, die Hoffnung auf das Leben, die Perspektive, auf neuen Wegen nie allein zu gehen. Aus dieser Weite lassen sich alle Wirklichkeiten betrachten. Das schult das Gewissen. Aus dieser Weite heraus lassen sich die Wirklichkeiten gestalten, so sehr sie auch zu umzingeln scheinen. Das hilft aus der Enge und lässt Flügel wachsen, damit Menschen einander „Medium der Befreiung“ sein können, wie es Maria-Sibylla Lotter ausdrückte4.
„Flügel & Gewissen“ lautet unser Jahresthema 2024.
Zurück zum Zitat vom Anfang. „Wenn Menschen nach Antworten auf Fragen der Gesellschaft suchen wollen, unterstütze ihre Gewissensbildung. Wenn sie sie gemeinsam gestalten, schenke ihnen Flügel.“ So möchten wir das Jahr 2024 mit Ihnen beginnen, mit ihnen suchen und gestalten. Mit Tiefe und in Weite.
Dr. Angela Reinders, Direktorin
1 Robert Habeck in der letzten Ausgabe der Talkshow "Anne Will" Die Welt in Unordnung – Ist Deutschland den Herausforderungen gewachsen?", 3. Dezember 2023, https://daserste.ndr.de/annewill/videos/Die-Welt-in-Unordnung-Ist-Deutschland-Herausforderungen-gewachsen,annewill8222.html
2 Niklas Luhmann, Die Gewissensfreiheit und das Gewissen, in: Archiv des öffentlichen Rechts, 90, 3 (1965), 257-286, hier: 264.
3 Eberhard Schockenhoff, Das Gewissen: Quelle sittlicher Urteilskraft und personaler Verantwortung [= Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle Mönchengladbach (Hg.), Kirche und Gesellschaft, 269], Köln 2000, 7f.
4 Maria-Sibylla Lotter, Scham, Schuld, Verantwortung. Über die kulturellen Grundlagen der Moral, Berlin 2012, 121.